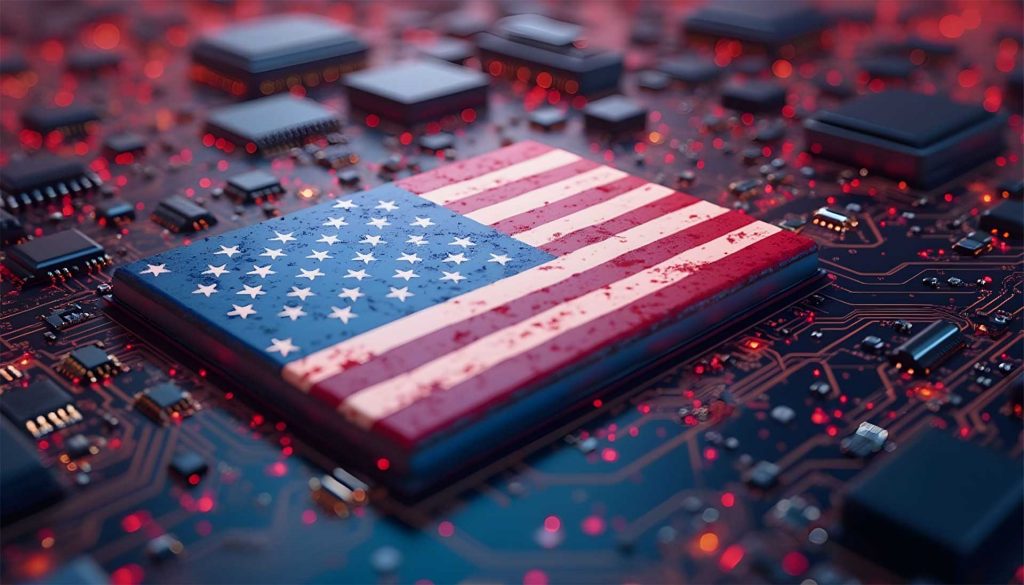
Über die zunehmende staatliche Intervention in der US-Wirtschaft: Jüngste Tendenzen, Motive, Auswirkungen – und neue Einnahmequellen
Hand aufs Herz: Erinnern Sie sich noch an die letzte politische Amtshandlung des (damals bereits abgewählten) Präsidenten Obama im Dezember 2016? Wir – bis auf einen Mauersegler, der sich zu dieser Zeit en Detail mit der Thematik auseinandersetzen musste – auch nicht. Es handelte sich um die formale Ablehnung der Übernahme einer börsengelisteten deutschen (!) Firma durch ein chinesisches Unternehmen. Die Begründung: Die Übernahme würde den sicherheitspolitischen Interessen der USA entgegenstehen. Eine tiefergehende Begründung wurde nicht veröffentlicht.
Was damals eine Ausnahme hinsichtlich staatlicher Eingriffe in privatwirtschaftliche Belange darstellte, hat zuletzt deutlich an Fahrt aufgenommen: Der amerikanische Staat greift wesentlich häufiger in wirtschaftliche Prozesse ein, um strategische Interessen der USA zu wahren. Diese Tendenz, die sich seit 2024 verstärkt hat, umfasst Maßnahmen wie Subventionen, Beteiligungen an Unternehmen und regulatorische Auflagen bei Fusionen. Im Kontext geopolitischer Spannungen, insbesondere mit China, sowie innenpolitischer Prioritäten wie Arbeitsplatzsicherung und technologischer Souveränität, greift die US-Regierung – zunächst unter Präsident Joe Biden und nun nochmals verstärkt unter Donald Trump – zunehmend in die freie Wirtschaft ein. Primär fokussiert sich die „neue Industriepolitik“ der US-Regierung auf die Sektoren Rüstung, Halbleiter und Technologie. Wir versuchen im Folgenden die Motive hinter diesen Interventionen und ihre positiven und negativen Auswirkungen zu analysieren.
Die Gründe für die zunehmenden Eingriffe der US-Regierung in die freie Wirtschaft sind vielfältig. Die wesentlichen Ursachen sind in einem sich stark verändernden geopolitischen Umfeld zu finden, in dem die USA Gefahr läuft, ihre wirtschaftliche und politische Führungsrolle zu verlieren. Zunächst steht die nationale Sicherheit im Vordergrund. In einer Ära geopolitischer Rivalitäten, vor allem mit China, zielt die US-Politik darauf ab, die Abhängigkeiten von nicht amerikanischen Anbietern zu reduzieren. Die Covid-Krise hat die Verwundbarkeit von Volkswirtschaften durch die globalisierten Lieferketten deutlich aufgezeigt. Seltene Erden, Halbleiter oder herkömmlicher Baustahl sind dabei nicht nur wirtschaftliche Güter, sondern strategische Ressourcen, die für Verteidigung, Technologie und Energieübergang essenziell sind und bei denen daher zukünftig keine extreme Abhängigkeit von unsicheren Drittstaaten wie China mehr bestehen soll. Die Biden-Administration hat dies durch Gesetze wie den Inflation Reduction Act (IRA) und den CHIPS and Science Act von 2022 institutionalisiert, die mit Milliarden an Subventionen die einheimische Produktion stärken sollte. Die Regierung Trump hat diese Linie forciert indem sie via Zoll-Deals viele Länder drängt, über verstärkte Direktinvestitionen in den USA nachzudenken.
Ein weiteres Motiv der amerikanischen Industriepolitik ist der Schutz von Arbeitsplätzen und die Förderung wirtschaftlicher Resilienz. Obwohl sich die US-Wirtschaft von Inflationsschock und der Pandemie erholt, bleiben doch frappierende regionale Ungleichheiten – etwa in den Rust-Belt-Staaten (traditionelle Industrieregion, die stark unter dem Strukturwandel der letzten Jahrzehnte gelitten haben). Interventionen in der Metallindustrie sollen daher Jobs in Schlüsselindustrien erhalten und neue schaffen – und damit Wähler halten bzw. neue hinzuzugewinnen.
Schließlich treibt der technologische Wettbewerb mit China die Politik an. Die USA wollen ihre Führung gerade in zukünftigen Schlüsseltechnologien wie KI und Quantencomputing behaupten, was staatliche Investitionen erfordert. Diese Motive spiegeln eine Rückkehr zu einer „subsidy-driven industrial welfare policy“ wider, wie es der Joint Economic Report 2025 beschreibt, der an die New-Deal-Ära aus den 30er Jahren erinnert, aber mit modernen geopolitischen Akzenten.

Ein prominentes Beispiel ist die Beteiligung der US-Regierung an MP Materials, dem einzigen produzierenden Seltenerd-Unternehmen in den USA. Im Juli 2025 schloss das US-Verteidigungsministerium (DoD) eine Milliarden-Partnerschaft mit MP Materials ab, um die Produktion von Seltenerd-Magneten in den USA auszuweiten und das Quasi-Monopol Chinas in diesem Bereich zu brechen. Das DoD kaufte zudem Vorzugsaktien im Wert von 400 Millionen Dollar und wurde somit zum größten Aktionär. Zudem stellte das Office of Strategic Capital einen Kredit von 150 Millionen Dollar bereit. All diese Maßnahmen zielen darauf ab, die US-Versorgung mit seltenen Erden zu sichern, die für Militärtechnik und Elektrofahrzeuge unerlässlich sind. Die Regierung gewährleistet zudem einen Preisboden von 110 Dollar pro Kilogramm, um gegen chinesische Dumpingpreise anzukämpfen. Dies markiert einen signifikanten Wandel in der US-Rare-Earth-Politik und unterstreicht das Motiv der nationalen Sicherheit.
Ein weiteres Beispiel ist die Zustimmung zum Verkauf von US Steel an Nippon Steel unter strengen Auflagen. Im Januar 2025 blockte Präsident Biden den 14,9 Milliarden Dollar schweren Deal aus Gründen der nationalen Sicherheit. Nach dem Amtsantritt Trumps wurde er im Juni 2025 genehmigt, jedoch mit einem „Golden Share“ für die US-Regierung. Diese goldene Aktie gewährt dem Weißen Haus Vetorechte, etwa über Schließungen, Stilllegungen oder Verkäufe von Standorten bis 2035. Nippon Steel verpflichtete sich zudem zu 11 Milliarden Dollar Investitionen in US Steel bis 2028. Diese Bedingungen schützen Arbeitsplätze in Pennsylvania und anderen Bundesstaaten und geben der Regierung erheblichen Einfluss.
Schließlich die Beteiligung an Intel: Durch den CHIPS Act erhielt Intel im November 2024 unter Präsident Biden 7,9 Milliarden Dollar an Subventionen, um die Halbleiterproduktion in den USA auszubauen. Der Act sieht insgesamt 39 Milliarden Dollar Förderungen vor, ergänzt um 25-prozentige Steuergutschriften. Unter Trump wurde dies im August 2025 erweitert: Im Austausch für weitere 8,9 Milliarden Dollar erhält die Regierung einen 10-prozentigen Aktienanteil an Intel. Dies soll Unsicherheiten über die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens beseitigen und die US-Chip-Industrie stärken, die bisher stark von taiwanesischen und chinesischen Lieferanten abhängig ist. Im Gegenzug investiert Intel über 100 Milliarden Dollar in Fabriken in Arizona, Ohio und anderen Staaten.
Stichwort Halbleiter: Denkbar scheinen für die Regierung Trump auch Anteile an weiteren US-Firmen aus dem Sektor wie an dem Speicherchiphersteller Micron. Gelegentlich werden sogar ausländische Firmen (wie TSMC oder Samsung) als mögliche Beteiligungsziele genannt, da die Firmen aufgrund des genannten Chips Act größere US-Direkt-Investitionen vornehmen und damit Fertigungskapazitäten in den USA aufbauen. Allerdings ist für uns nur schwer vorstellbar, wie dies in der Praxis aussehen könnte. Andererseits scheinen der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Dies zeigt das Beispiel Nvidia:
Präsident Trump hat Verhandlungen mit Nvidia-CEO Jensen Huang und AMD angekündigt, um 15% der Einnahmen aus bestimmten Chip-Verkäufen nach China an die US-Regierung abzutreten. Dies wäre keine Beteiligung im eigentlichen Sinne. Ziel ist es vielmehr, Einnahmen aus sensiblen Technologien zu sichern und nationale Interessen zu wahren. Nvidia, als Marktführer in KI-Chips, und AMD könnten hierdurch gezwungen sein, ihre China-Geschäfte anzupassen.
Wenn man die aktuelle Presse in den USA verfolgt, so drängt sich die Vermutung auf, dass die aktuelle Regierung erwägen könnte, ebenso bei großen Rüstungsunternehmen direkte Aktienpositionen einzugehen. Dies würde die Verteidigungsindustrie stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten reduzieren. Speziell Lockheed Martin wird hierbei als potenzielles Ziel genannt, weil das Unternehmen als größter US-Rüstungskonzern für Flugzeuge wie die F-35 verantwortlich ist.

Berater wie der Direktor des nationalen Wirtschaftsrats der Vereinigten Staaten Kevin Hassett schlagen vor, dass die USA deutlich mehr Anteile an US-Unternehmen übernehmen sollten – potenziell finanziert durch die Auflage eines neuen Sovereign Wealth Fund. Dies würde eine systematische Steuerung von Branchen wie Technologie, Verteidigung und Rohstoffe ermöglichen. Als Vorbild sieht man hier Norwegen und Singapur, die eine proaktive staatliche Steuerung und eine enge Partnerschaft zwischen Staat und Wirtschaft verfolgen.
Wir betrachten die Entwicklungen in den USA mit gemischten Gefühlen. Auf der positiven Seite gibt es gute Gründe für die staatlichen Interventionen. Zunächst fördern sie die wirtschaftliche Resilienz: Durch Sicherung kritischer Lieferketten reduzieren die USA Abhängigkeiten, was in Krisen wie in einer Pandemie oder geopolitischen Konflikten entscheidend sein kann. Darüber hinaus sehen wir einen weiteren überlegenswerten Punkt: Anstatt in Krisenzeiten überschuldete Banken oder Autofirmen zu retten (in der Hoffnung, dass man seinen Einsatz zumindest teilweise wieder zurück bekommt – siehe die globale Finanzkrise) steckt in den Beteiligungen in wachstumsträchtigen Firmen auch die Möglichkeit, diese Investments zukünftig mit deutlichen Kursgewinnen zu monetarisieren. In Zeiten, in denen nahezu alle westlichen Staaten Schulden in Rekordhöhe aufnehmen, ist die Erschließung potenziell neuer Einnahmequellen begrüßenswert.
Dem gegenüber bergen staatliche Beteiligungen auch erhebliche Risiken: Politische Einmischung kann – was man in der volkswirtschaftlichen Theorie schon lange weiß – zu Ineffizienzen der sogenannten „Fehlallokation der Mittel“ führen. Subventionen verzerren Märkte und erhöhen zu ihrer Finanzierung die Steuerlast. Bei US Steel könnte die „Golden Share“ zum Beispiel Investoren abschrecken und Innovationen behindern, weil das Unternehmen unter ständiger Regierungsaufsicht steht. Politische Abhängigkeiten könnten insbesondere Technologieunternehmen wie Intel eher lähmen als innovativer zu machen. Handelskonflikte, wie die durch Präsident Trump massiv ausgeweiteten Zölle, belasten darüber hinaus die gewachsene effiziente Lieferketten und treiben Preise nach oben, was die Inflation anheizt. Zudem besteht das Risiko von „Interventions-Spiralen“, bei denen eine Maßnahme weitere Eingriffe nach sich zieht, um die erhofften Erfolge zu erreichen.
Die Abkehr der US-Regierung von einer auf Liberalismus basierenden Wirtschaftspolitik, lässt sich tendenziell ebenso in Europa beobachten, auch wenn in Europa staatliche Eingriffe in die Wirtschaft eine wesentlich längere Tradition haben. Wer erinnert sich nicht an die Übernahme der Augsburger Industrieperle, dem Roboterhersteller KUKA durch die chinesische Midea Group im Jahr 2016, die mit Squeeze-Out von der Börse ihren Abschluss fand? Die Bundes- und Landesregierung konnte damals nicht schnell genug ein Gerüst für die Abwehr von ausländischen Übernahmen aufsetzen, um die Übernahme von KUKA noch zu verhindern. 2017 wurde dann aber auf EU-Ebene mit Frankreich und Italien zusammen ein entsprechender Rahmen geschaffen und die Außenwirtschaftsverordnung geändert. Eckpunkte der deutschen „Nationalen Industriestrategie 2030“ sahen bereits 2018 Maßnahmen vor, bei Übernahmeversuchen von Unternehmen der kritischen Infrastruktur, dies von Seiten der Bundesregierung zu überprüfen und gegebenenfalls durch staatliche Beteiligungen zu verhindern. Selbst ein eigens dafür aufgesetzter Staatsfonds war zu dieser Zeit schon geplant, wurde aber bis heute nicht realisiert.
Anders in Frankreich: Dort sind über verschiedene staatliche Investmentvehikel 85 Unternehmen (unter anderem Airbus, Renault, Vinci, Engie, Orange, Aeroporte de Paris) ganz oder teilweise in Staatshand. Aber auch ohne einen speziellen „strategischen Fonds“ gibt es in Deutschland eine Reihe prominenter Staatsbeteiligungen: Fraport, Commerzbank, Lufthansa und Curevac, VW, Salzgitter und Airbus, um nur einige zu nennen.
Sehr geehrte/geehrter…
zusammenfassend lässt sich festhalten: Die ehemals von den Amerikanern als sozialistisch beschimpfte und mitleidig belächelte europäische staatliche Beteiligungspolitik hat auch im Weißen Haus Einzug gehalten. Hierfür gibt es gute Gründe. Wie zum Beispiel den unfairen Wettbewerb durch die subventionsgetriebene Wirtschaftspolitik von Staaten wie China und das Risiko zunehmender geopolitischer Konflikte. Der Trend zu einem zunehmenden Staatskapitalismus in der westlichen Welt könnte längerfristig allerdings das globale Wachstum belasten. Denn man lernt schon im ersten Semester Volkswirtschaftslehrte, was in der Realität häufig bestätigt wurde: Der Staat ist kein guter Investor!
Hoffen wir, dass die negativen Auswirkungen überschaubar bleiben und durch die staatlich angestoßenen Investitionsprogramme auf beiden Seiten des Atlantiks mehr als kompensiert werden. Insgesamt erscheint uns die Stoßrichtung der Wirtschaftspolitik in Europa aktuell vielversprechender als in den USA, weshalb wir weiter an eine relative Outperformance der zudem deutlich günstiger bewerteten europäischen Börsen glauben. Risikofaktor ist hierbei – wie auch in den Vereinigten Staaten – die weiter steigende Staatsverschuldung. Umgedreht sind wir weiter davon überzeugt, dass die auf KI basierende industrielle Revolution erst am Anfang steht und in den kommenden Jahren erhebliche Wachstumschancen eröffnen sollte. Wir sehen uns daher mit unserem auf zukunftsträchtige Unternehmen ausgerichteten Investmentansatz weiter gut aufgestellt.
Zu guter Letzt: Mit Heinz-Gerd Vinken geht ein weiterer Mauersegler in den wohlverdienten Ruhestand. Er bleibt uns aber als Berater freundschaftlich verbunden.
Heinz-Gerd, vielen Dank für alles, was Du für APUS und unsere Investoren geleistet hast. Für die Zukunft wünschen wir Dir als rheinischen Jungen alles Gute und: „Maach et joot!“
Mit besten Grüßen von den Mauerseglern aus Frankfurt!
Jürgen Kaup, Stefan Meyer, Johannes Ries, Uwe Schupp und Roland Seibt